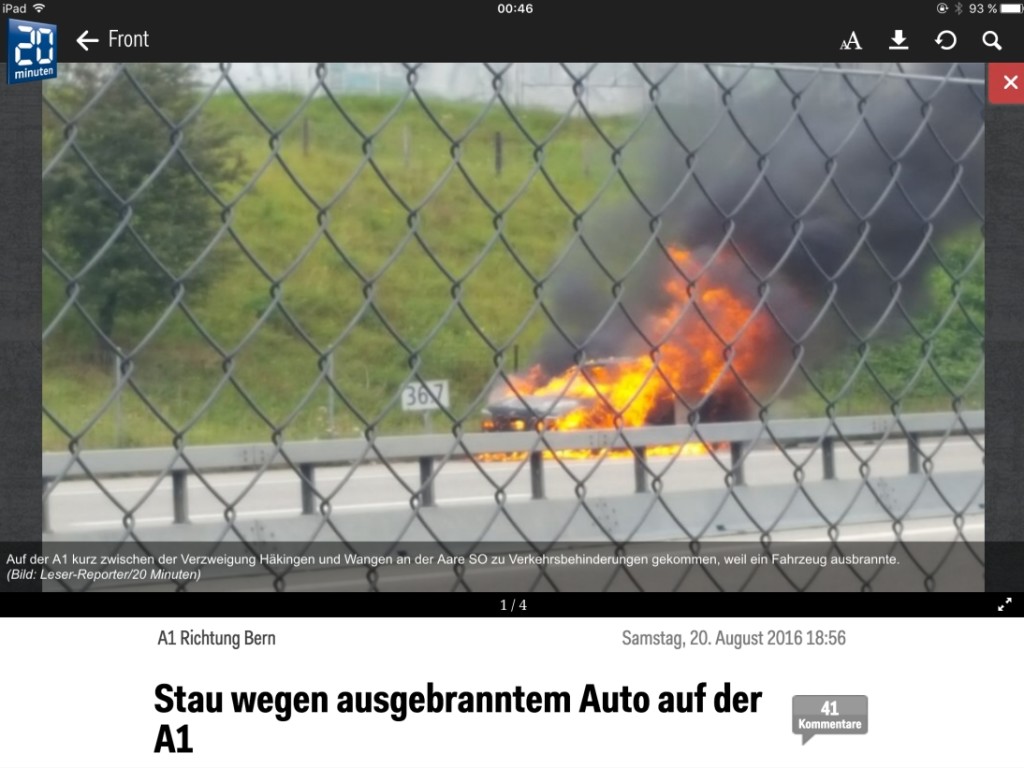Es ist so richtig kalt geworden im Mittelland und bald fällt wohl der erste Schnee. Und wenn das passiert, tauchen in den Verkehrsmeldungen gelegentlich auch Verspätungen im öffentlichen Verkehr und Zugsausfälle auf. «Grund dafür ist eine Stellwerkstörung», heisst es nicht selten zuletzt. Doch: Was ist eine Stellwerkstörung?
Best of rc. @ Wynentaler Blatt 2016
 Stellwerkstörungen können bei jeder Witterung auftreten und haben eher selten damit zu tun, dass zu viel Schnee auf den Schienen liegt. Bei der SBB ist zu erfahren, dass ein Zug von Bern nach Zürich an insgesamt 500 Weichen und 140 Signalen vorbeifährt. Der Zug bewegt sich jedoch nur, wenn der Computer an keinem dieser Passagen ein Problem feststellt. Meldet einer der weiteren 200 000 Relaiskontakte entlang der Strecke einen Fehler, muss dieser erst behoben werden, bevor der Zug passieren darf.
Stellwerkstörungen können bei jeder Witterung auftreten und haben eher selten damit zu tun, dass zu viel Schnee auf den Schienen liegt. Bei der SBB ist zu erfahren, dass ein Zug von Bern nach Zürich an insgesamt 500 Weichen und 140 Signalen vorbeifährt. Der Zug bewegt sich jedoch nur, wenn der Computer an keinem dieser Passagen ein Problem feststellt. Meldet einer der weiteren 200 000 Relaiskontakte entlang der Strecke einen Fehler, muss dieser erst behoben werden, bevor der Zug passieren darf.
«Sicherungsanlagen» wird die Gesamtheit dieser Melder genannt. Auf einem überschaubaren Streckenabschnitt ist die Ursache schnell gefunden und behoben – und löst kaum ein mehrstündiges Chaos aus. Tritt der Fehler aber an einem Knotenpunkt auf, an dem sich viele Strecken überschneiden und Minute für Minute Züge passieren, kann dies zu einer regelrechten Kaskade führen – es entsteht theoretisch ein Stau.
Umleiten, ersetzen, ausfallen lassen
Gründe für eine Stellwerkstörung – oder richtiger: eine «Gleisfreimeldestörung» – gibt es viele. Das kann eine defekte Lampe einer Lichtsignalanlage sein, ein Zug der stehen geblieben ist, eine Weiche deren Stellung zum Beispiel wegen Schnee und Eis unklar ist, oder eine Barriere die sich nicht schliesst. Damit es nicht tatsächlich zu einem Stau kommt – die Züge dürfen ja nur in einem gewissen Abstand hintereinander her fahren – werden Züge umgeleitet, es werden Bahnersatzbusse organisiert oder im schlimmsten Fall kommt es zu Zugsausfällen. Fährt nur jede Stunde ein Zug in die gewünschte Richtung, ist das ein Ärgernis.
6000 Schaltungen pro Sekunde
Und dennoch: Unser Schienennetz ist äusserst zuverlässig und das obwohl die Schweiz den weltweit dichtesten Fahrplan mit dem am stärksten belegten und beanspruchten Schienennetz besitzt. Täglich müssen 500’000’000 (500 Millionen!) Schaltungen funktionieren, das sind pro Sekunde 6000. Dabei ergeben sich pro Tag laut Angaben der SBB im Schnitt gerade mal 17 Störungen, die von den 450 Sicherungsanlagentechnikern der Bundesbahnen für Reisende fast unbemerkt behoben werden.
Funktioniert beispielsweise eine Weiche nicht richtig, wird zuerst der Streckenabschnitt gesperrt und die Weiche durch hin- und herbewegen mehrmals gestellt. Das passiert per Mausklick und hilft schon oft, wenn etwa ein Stein eingeklemmt ist. Nützt das nichts, wird ein Techniker aufgeboten, der binnen einer halben Stunde vor Ort sein muss. In vielen Fällen ist etwas eingeklemmt, oder es fehlt der Weiche an Schmiermittel, die Weichenheizung ist defekt oder der Kontakt zum Sensor ist verstaubt.
Dieser Artikel ist im Wynentaler Blatt Nr. 07/2016 erschienen. Texte in der Zeitung. Sie haben den Nachteil, dass man die richtige Ausgabe gekauft haben muss, um sie (nach-)lesen zu können. Egal ob es der grösste Schrott war, oder ein Glanzlicht der Weltliteratur: Verpasst man die Zeitung, ist der Text für immer weg. Aus diesem Grund lege im Goggiblog meine eigenen kleinen Perlen aus dem Wynentaler Blatt ab, von denen ich glaube sie seien erhaltenswert. Für die Ewigkeit konserviert, sozusagen.