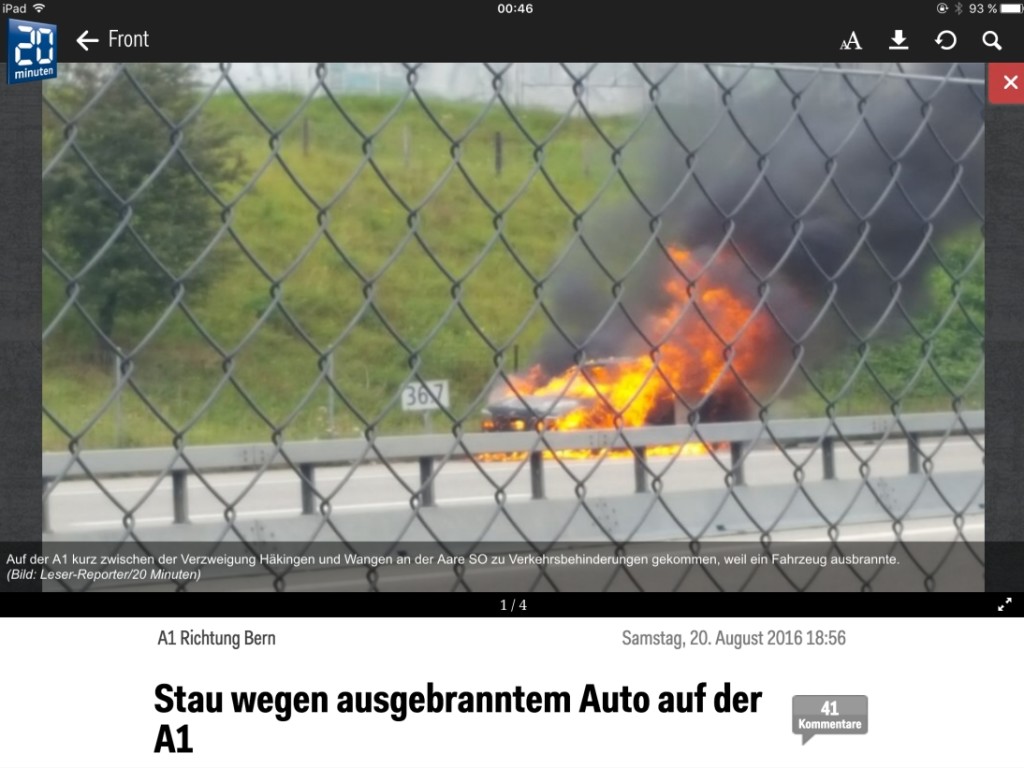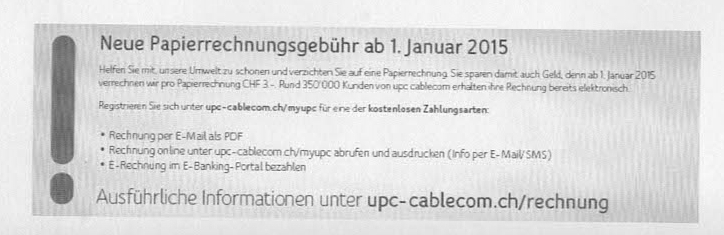Endlich berichten die nationalen Medien über Eishockey in der Nationalliga B. Zwar über eine Geschmacklosigkeit – aber der Leser will es ja so.
Als ich dieser Tage einen Schnellschuss-Reporter darauf ansprach, warum er aus einem drei Stunden dauernden Anlass eine 10 Sekunden-Szene zum Anlass nimmt, seine Zeitung Seitenweise damit zu befüllen, sagte er: „Der Leser will das so“.
 Der Anlass für meine Frage war ein wirklich geschmackloses Handeln von ein paar wenigen Individuen, die beim Eishockey-Spiel Olten-Langenthal auf einem Transparent ankündigten, den Gegner in den Rollstuhl boxen zu wollen. In diesem Artikel geht es aber nicht um die Geschmacklosigkeit ansich, sondern um den medialen Umgang damit.
Der Anlass für meine Frage war ein wirklich geschmackloses Handeln von ein paar wenigen Individuen, die beim Eishockey-Spiel Olten-Langenthal auf einem Transparent ankündigten, den Gegner in den Rollstuhl boxen zu wollen. In diesem Artikel geht es aber nicht um die Geschmacklosigkeit ansich, sondern um den medialen Umgang damit.
Tatsache ist, dass Olten-Fans während 99% des Anlasses keinerlei Transparente in die Luft gestreckt haben. Tatsache ist auch, dass ein dämliches Ereignis zum Glück nur von ein paar Hundert Zuschauern im Stadion wirklich wahrgenommen wurde. Das war übrigens auch beim fahrlässigen Einsteigen von Sandro Wieser gegen Gil Yappi der Fall, oder beim Vierfachmord von Rupperswil. Ungeachtet der wirklich schlimmen Tragik die hinter einem Ereignis steckt, ist die eigentliche Katastrophe die Verarbeitung in den Medien.
Nüchtern betrachtet, wurde der Vierfachmörder letztlich auch ohne öffentliche Empörung hinter Gitter gebracht und wird seine Strafe bekommen. Auch Sandro Wieser hat seine Strafe abgesessen und hat an Erfahrung dazu gelernt. Yappi geht es wieder bestens, auch wenn er mit dem FC Zürich irgendwann sportlich abgestiegen ist. Und den Transparent-Malern die sich inzwischen gestellt haben, wird es ähnlich ergehen. Man hat sie erwischt, man wird sie bestrafen.
Fertig. Würde man meinen
Irgendwann ist die Informationspflicht der Medien erfüllt. Doch in allen drei Fällen – so unterschiedlich sie sind – fängt erst jetzt eine unaufhaltsame Maschinerie an zu laufen, die für mein Empfinden das eigentlich Verwerfliche ist: Mit dem Anspruch schneller, aktueller, exklusiver und attraktiver für Konsumenten und damit für Werbepartner (oder umgekehrt) zu sein, überbieten sich die Medienhäuser mit Superlativen: Aus dem Mörder wird eine Bestie, Rupperswil zum abscheulichsten Dorf der Schweiz. Sandro Wieser wurde zum Horror-Treter und Fussball allgemein zur Dreckssportart. Ebenso trifft es den EHC Olten: Ein Transparent, das zum Glück schnell weggeräumt war und kaum wahrgenommen wurde, schafft es millionenfach angeklickt in die Medienwelt. Erst dank der medialen Maschinerie wurde ein dummes Transparent erst zum unmenschlichen Skandal befördert, unter dem nicht die Täter, sondern der EHC Olten leiden muss.
Hat jemand mitbekommen, dass das Verfahren gegen Wieser eingestellt wurde? Erinnert sich jemand an das Resultat des Spiels Olten – Langenthal? Ach ja, ganz vergessen: Sowas rückt natürlich in den Hintergrund, bei so einem Ereignis.
„Der Leser will das so“
Immer wieder dieses Zitat. Will er das wirklich? Gemessen an den Reaktionen zum Olten-Transparent könnte man sagen, ja: Hunderte von Likes und ebenso oft geteilte Beiträge. Harsch die Wortwahl in den unzähligen Kommentaren, in denen „der Leser“ den Tätern mindestens ebenso krankes Zeug wünscht, wie auf dem Spruchband zu lesen war. Krankes Zeug auf dem Spruchband krankes Zeug in den Kommentaren, halten die Redaktionen für akzeptabel. Eigenartige Logik.
Ist „der Leser“ tatsächlich nur Sensationsgeil und im Grunde ein böser Mensch? Erwischen wir ihn gerade, wie er Formel 1 nur dann guckt, wenn auch mal ein paar Autos demoliert werden? Wäre Fussball ohne Horror-Treter und nur zwischendurch mal einen Mörder in der Gegend zu langweilig für „den Leser“ … oder für den „geschmacklosen Willen des Lesers“, wenn man die ursprüngliche Aussage einfach mal gedankenlos ergänzen will?
Eher nicht. „Der Leser“ wollte primär nur unterhalten werden und in einer Weltordnung leben, die ihm eine persönliche Entfaltung öffnet und Sicherheit bietet. Alles andere hat man uns angezüchtet, vor allem den Hass auf Fehler die andere begehen und die Möglichkeit per Kommentar wahllos auf die Sünder einzuschlagen.
Leider bringt dieser Blogbeitrag nur mir persönlich etwas, Schreiben ist bekantlich eine Art Therapie. Vielleicht erntet er ein paar Likes, ändern wird er aber gar nichts. Bei nächster Gelegenheit lesen wir in der Zeitung, dass ein fröhliches Fussballspiel auf die eine Petarde reduziert wird, dass ein dreitägiges fröhliches Volksfest mit einem gewaltsamen Polizeieinsatz überschattet wurde und dass der Fummelprinz aus dem Big Brother Haus geflogen ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Oder eigentlich doch nicht. Im Grunde ist es das Gleiche: „Der Leser will das so“.
Symbolbild: Eishockey.ch